Das Bundeskabinett hat am 22. Mai 2024 den Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes (GVSG) beschlossen. Durch das GVSG wird nach Auffassung des Bundesgesundheitsministeriums der Hausarztberuf attraktiver, die ambulante regionale Versorgung gestärkt, die hausärztliche und die ambulante psychotherapeutische Versorgung weiterentwickelt, der Leistungszugang verbessert und die Transparenz erhöht.
Aus Sicht des Berufsverbands ist dies ein lobenswerter Ansatz, es bleiben jedoch viele Fragen offen. Das angedachte Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz greift weiterhin deutlich zu kurz, um die niedergelassenen Ärzte und damit die ambulante Versorgung maßgeblich zu stärken.
Entbudgetierung der Hausärzteschaft
Intention der Gesetzesbegründung ist, dass andere Arztgruppen von der Hausarzt-Entbudgetierung nicht betroffen sein sollen. Die Stärkung und Entlastung von medizinisch unnötigen Arztkontakten sollen unter anderem zwei neue jahresbezogene Pauschalen für Hausarztpraxen im EBM bringen. Bei beiden ist entscheidend, welche Details der Bewertungsausschuss noch festlegt und dass dieser auch seinen Gestaltungsspielraum im Sinne der Praxen nutzt. Beide Pauschalen sollten idealerweise mit einem Praxis-Patienten-Kontakt ausgelöst werden können.
Bei der neuen Vorhaltepauschale, die die heutige 03040 EBM ersetzen soll, gibt der Gesetzentwurf aktuell teilweise kaum erfüllbare Kriterien vor, kritisiert der Verband der Hausärztinnen und Hausärzte. So seien Samstags- oder Abendsprechstunden nicht flächendeckend erfüllbar und sollten gestrichen werden, um auch Nachwuchsärzte nicht vom Hausarztberuf abzuschrecken.
Ebenso komplex ist die Umstellung bei der Versorgungspauschale. Mit dem Wechsel von einem Arzt-Patienten- auf einen Praxis-Patienten-Kontakt könnten nicht nötige Arztkontakte gesenkt werden. Zudem bräuchten nicht alle Menschen mit einer chronischen Erkrankung eine intensive Betreuung. Es müsse daher klar definiert werden, was einen „leichten Chroniker“ von einer intensiven Betreuung unterscheide. Wer aufwändige Betreuung braucht, für den sollten Hausärztinnen und Hausärzte weiter die quartalsabhängige Chroniker- und Versichertenpauschale samt Zuschlägen abrechnen können, fordert der Hausärzte-Verband. Diese Leistungen müssten adäquat vergütet werden, um den Aufwand abzubilden und keine Fehlanreize für die Versorgung zu setzen. Sollte sich die Gesundheit von Menschen im Laufe eines Jahres verschlechtern und die Behandlung intensiviert werden, müsse zudem ein Wechsel von der Jahres- auf die Quartalspauschale möglich sein. Sonst birgt die geplante Regelung die Gefahr der Fehlsteuerung weg von schwerer chronisch erkrankten Patientinnen und Patienten hin zu weniger betreuungsintensiven Patienten.
Die Versorgungspauschale soll – bis auf Ausnahmen wie Hausarztwechsel – nur eine Praxis abrechnen können. Dies widerspricht der Realität, da durchschnittlich ca. 35 Prozent der gesetzlich versicherten chronisch erkrankten Patienten mehr als einen Hausarzt in Anspruch nähmen, der die Versichertenpauschale berechne.
In Bezug auf die Entbudgetierung ist die im Entwurf definierte Bereitstellung der Mittel aus der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV) für die hausärztliche Versorgung auf Basis des prozentualen Honoraranteils der Hausärzte problematisch, da aus der MGV im Moment auch Geld für gesetzliche Aufgaben wie den Strukturfonds entnommen werden. Nach dem vorliegenden Entwurf würden diese MGV-Anteile gegebenenfalls zulasten anderer Arztgruppen rechnerisch den Hausärzten zugeschlagen. Der Berufsverband der Deutschen Urologie unterstreicht, dass dieses Vorgehen nicht der Intention der Gesetzesbegründung entspricht, nach der andere Arztgruppen von der Hausarzt-Entbudgetierung nicht betroffen sein sollen.
Wenn die Entbudgetierung der Hausärzteschaft kommt, was geschieht dann mit den Verträgen zur Hausarztzentrierten Versorgung (HZV)? Über 6 Millionen Patienten und mehr als 16.000 Hausärztinnen und Hausärzte nehmen freiwillig an dieser modernen Form der Versorgung teil. Haben Hauärztinnen und Hausärzte dann überhaupt einen Vorteil?
Wie ist die Regelung, wenn Patientinnen und Patienten unterjährig kommen?
Der Berufsverband der Deutschen Urologie geht davon aus, dass die Hausärzteschaft nach erstem Kontakt zu einem Patienten genauso verfährt wie bisher und diesen weiter an Fachärzte überweist. Der dem Gesetz zugrundeliegende Ansatz, dass Patientinnen und Patienten schneller einen Termin beim Hausarzt oder der Hausärztin bekommen, ist gut, bringt aber keinen versorgungspolitischen Vorteil für die Versicherten, wenn diese anschließend keinen fachärztlichen Termin bekommen. Laut Spitzenverband Fachärztinnen und Fachärzte Deutschlands (SpiFa)erhalten 95 Prozent aller Erkrankungen ihre endgültige Diagnose erst in der fachärztlichen Versorgungsebene. Erst dann kann eine definitive Behandlung stattfinden.
Auszahlungsquote für die Hausärzteschaft
Die Auszahlungsquote für die Hausärzteschaft steht fest. Somit müsste auch Klarheit bestehen, welche Mehrkosten durch die Entbudgetierung anfallen. Der Minister bleibt in dieser Frage unverständlicherweise völlig vage mit der Aussage, dass die Kosten nicht endgültig absehbar seien. – nicht nachvollziehbar aus Sicht des BvDU.
Entbudgetierung für alle Fachärzte
Völlig offen bleibt im Gesetz, auf welche Weise Fachärztinnen und Fachärzte in Zukunft unterstützt werden sollen. Der Berufsverband unterstreicht seine Forderung, neben den Hausärzten alle Fachärzte zu entbudgetieren. Nur, wenn Hausärzte und Fachärzte an einem Strang ziehen, kann ein Zusammenwirken beider zum Wohle der Patienten und aus Sicht des Berufsverbands sogar zu einer Entlastung der Kassen führen.
In Baden-Württemberg funktioniert die hausarztzentrierte Versorgung deswegen gut, da beide – Hausärzte und Fachärzte – eine hohe pauschalisierte Vergütung erhalten. Zudem ist die Abrechnung von Leistungen in den Patienteninformationssystemen abgebildet und erlaubt so eine gute Steuerung von Patientinnen und Patienten.
Warum werden keine neuen Studienplätze der Medizin geschaffen?
Die von Lauterbach stets als dringlich bezeichnete Regelung zur Förderung zusätzlicher Medizinstudienplätze wurde im Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes gestrichen.
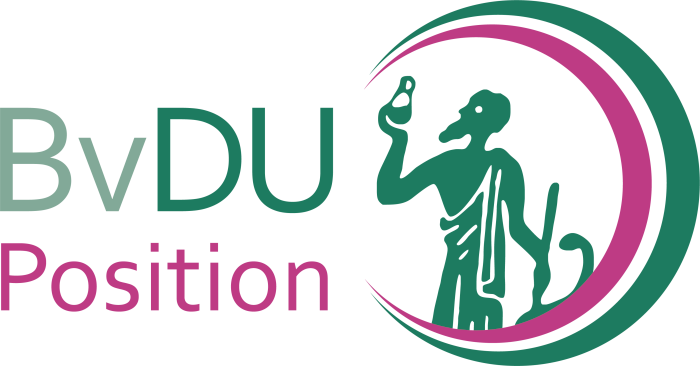
Aus Sicht des Berufsverbands ist es völlig unverständlich, dass nach wie vor nichts unternommen wird, um mehr Studienplätze zu schaffen. Angesichts einer zunehmend alternden, multimorbiden Patientenschaft, dem Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge in der Ärzteschaft und der Tatsache, dass die Teilzeitbeschäftigung bei Ärztinnen und Ärzten stark zunimmt, muss es in Zukunft mehr Köpfe an Ärztinnen und Ärzten geben. Warum kann verlässt sich die Politik darauf, dass Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland kommen? Warum lässt die Politik zu, dass (nur) die Eltern, die es sich leisten können, ihre Kinder auf private medizinische Hochschulen schicken, die deutschlandweit aus dem Boden schießen? Aus Sicht des Berufsverbands ist dies mehr als verstörend und höchst unsozial.
Wie soll die ambulante Weiterbildung in Zukunft finanziert werden?
Die operative Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung im ambulanten Sektor ist in der bisherigen Finanzierung nicht vorgesehen und muss daher dringend berücksichtigt werden.
Sind Gesundheitskioske endgültig vom Tisch? Künftig intensivere Prüfungen aufgrund der Einführung der Bagatellgrenzen für Arzneimittelregresse?
Was wird letztendlich aus den Gesundheitskiosken, die sang- und klanglos aus dem Referentenentwurf zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) verschwanden, jedoch durch Änderungsanträge kurz vor der finalen Beratung im Bundestag – im Zweifelsfall mit neuem Namen aufgrund des angedrohten Marken-Rechtsstreits – wieder in den GVSG-Entwurf reinrutschen könnten?
Auch die im Entwurf des GSVG verankerte Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 300 Euro für Regresse gegenüber Arztpraxen könnte obsolet sein, da zu erwarten ist, dass die Prüfungen pro Arzt intensiviert werden, um die Grenze von 300 € zu überschreiten. Hintergrund ist, dass die KVen eine starke Zunahme der Medikamentenprüfungen, auch beim Off-Lable-Use, feststellen.
Wie erfolgt die Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Strukturen?
Der Berufsverband kann nicht nachvollziehen, inwiefern es durch die Bildung kommunaler MVZ zu einer Verbesserung der Versorgung kommen sollte. Warum sollte hier ein weiteres Risiko auf Kommunen abgewälzt werden, die auf Kosten des Trägers gehen, durch den Einkauf teurer Ärztinnen und Ärzte für die Praxen?
Eine flächendeckende telemedizinische Versorgung und Betreuung von Patientinnen und Patienten sieht der Berufsverband insbesondere in ländlichen Regionen kritisch. Diese wäre grundsätzlich begrüßenswert aus Sicht des Verbandes, widerspricht jedoch der digitalen Abdeckung des Landes, wie auch der Mentalität einer Bevölkerung. Je älter diese ist, umso weniger ist eine Umsetzung einer telemedizinischen Versorgung realistisch.
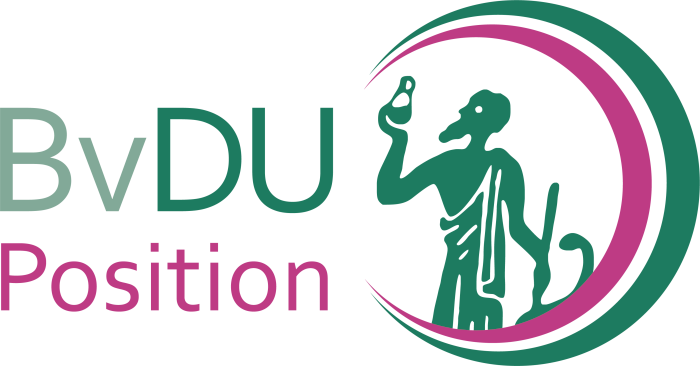
Es wird sich zeigen, ob das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz zu einer Veränderung der Überweisungshäufigkeit der Hausärzte an Fachärztinnen und Fachärzte führen wird. Aus fachärztlicher Sicht darf und wird eine gefühlte Bevorteilung der Hausärzteschaft nicht zu einer Spaltung der Fachärzteschaft führen. – Dann hätte der Minister endgültig sein Ziel erreicht. Zielsetzung muss sein eine Entbudgetierung aller Fachärzte.
Quellen: Bundesgesundheitsministerium (BMG), Ärzte Zeitung, Ärztenachrichtendienst (änd), Hausärztinnen- und Hausärzteverband

