Die Kritikpunkte und Vorschläge der Länder zum Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) bleiben weitgehend ungehört. Laut dem Entwurf sollen – wie bislang bereits geplant – neben Qualitätskriterien, die in dem neuen Entwurf für 65 Leistungsgruppen näher beschrieben werden, auch Mindestvorhaltezahlen je Leistungsgruppe gelten. Das lehnen die Länder ab. Einerseits, weil es sich dabei um eine neue Regelung handle, die nicht in dem vergangenen Juli von Bund und Ländern gemeinsam beschlossenen Eckpunktepapier enthalten sei. Andererseits, weil die Auswirkungen der Mindestvorhaltefallzahlen vollkommen unklar seien und sie als „erheblicher Eingriff in die Planungshoheit der Länder“ gewertet werden. Krankenhäuser dürfen bestimmte Behandlungen nur durchführen, wenn sie die Anforderungen dieser Leistungsgruppen erfüllen.
Die KBV-Vorstände erkennen im Gesetz Verstöße gegen Regelungen zum EU-Beihilferecht im KHVVG-Entwurf und wollen nun ernst machen: „Wir werden uns nun an die Europäische Kommission wenden mit der Bitte zu prüfen, ob eine mutmaßliche Beihilfeverletzung vorliegt.“ Damit folge man auch einem Auftrag der Vertreterversammlung. Problematisch bewertet die KBV, dass das Gesetz nur eine finanzielle Förderung ausschließlich der Krankenhäuser vorsieht.
Vorhaltevergütung
Die geplante Vorhaltevergütung soll laut dem BMG den wirtschaftlichen Druck auf Krankenhäuser senken. Mit dieser wird „die Vorhaltung von Strukturen in Krankenhäusern künftig weitgehend unabhängig von der Leistungserbringung zu einem relevanten Anteil gesichert“. Lauterbach betitelt das wohl wichtigste Ziel der Krankenhausreform als Entökonomisierung. Dazu soll das bisherige Fallpauschalensystem um die Vorhaltefinanzierung ergänzt werden. Wer wie viel wofür bekommt, soll künftig über eine komplizierte Berechnung ermittelt werden. War im letzten Referentenentwurf noch von „Aufträgen“ an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) im Zusammenhang mit der Ermittlung der Vergütung eines Vorhaltebudgets die Rede, sind es im Kabinettsentwurf nun „Verpflichtungen“.
Demnach soll das InEK Vorhaltevolumina als Summe von Vorhaltebewertungsrelationen ermitteln. Und zwar nach folgendem Schema: „Für die Ermittlung des Vorhaltevolumens für das jeweils folgende Kalenderjahr und ein Land, die bis zum 30. November eines jeden Kalenderjahres zu erfolgen hat, sind die nach in dem jeweiligen Kalenderjahr übermittelten Daten und die für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr übermittelten Leistungsdaten zu Krankenhausfällen, die mit bundeseinheitlichen Bewertungsrelationen vergütet werden, zugrunde zu legen und die Krankenhausfälle mit den Vorhaltebewertungsrelationen für das jeweils folgende Kalenderjahr zu bewerten.“ Davon ausgenommen sein sollen die Daten von Bundeswehrkrankenhäusern und von Krankenhäusern der gesetzlichen Unfallversicherung, in denen nicht zivile Patientinnen und Patienten behandelt werden oder in denen die Kosten von der gesetzlichen Unfallversicherung getragen werden.
Das ermittelte Vorhaltevolumen für ein Land soll auf Leistungsgruppen nach dem Verhältnis der Summe der Vorhaltebewertungsrelationen derjenigen Krankenhausfälle in dem jeweiligen Land, in denen Leistungen aus der jeweiligen Leistungsgruppe erbracht wurden, und dem Vorhaltevolumen des jeweiligen Landes rechnerisch aufgeteilt werden.
Das InEK soll nach dem jetzt vorliegenden Entwurf bis zum 30. September 2024 ein Konzept zur Vorgehensweise bei der Ermittlung des Vorhaltevolumens für ein Land, eine Leistungsgruppe und einen Krankenhausstandort erstellen und dieses – soweit erforderlich – aktualisieren. Das Konzept sowie spätere Aktualisierungen sollen auf der InEK-Internetseite veröffentlicht werden. Ab dem 1. Januar 2027 soll dann jedes Krankenhaus für jede Leistungsgruppe, die ihm zugewiesen wurde, ein Vorhaltebudget erhalten. Aber nur, wenn das jeweilige Krankenhaus die jeweilige standortbezogene Mindestvorhaltezahl erfüllt oder eine Ausnahmeregelung getroffen wurde.
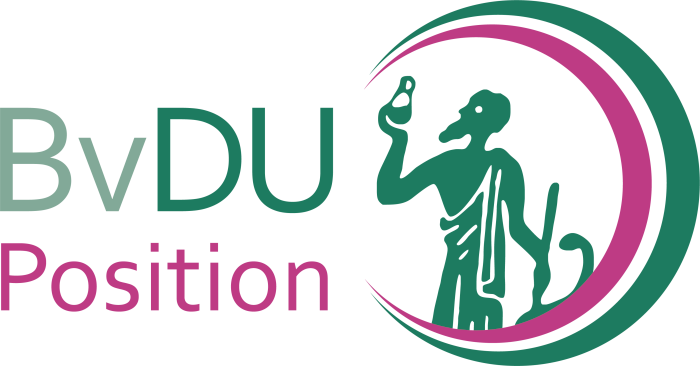
BvDU: So wird es nicht zu einer Entökonomisierung kommen
Aus Sicht des Berufsverbands wird es nicht zu einer Entökonomisierung kommen, da die Kliniken durch die Vorhaltepauschale zum einen rund 60 % allein für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen sollen. Dazu zählen das Vorhalten von Personal, einer Notaufnahme oder notwendige Medizintechnik. Die Vorhaltevergütung basiert weiterhin auf Vorjahresfällen, was den gewünschten Effekt einer Reduzierung der Fallzahlen möglicherweise untergräbt. Die bisherige Finanzierung der Krankenhäuser über Fallpauschalen, also pauschale Euro-Beträge pro Behandlungsfall beziehungsweise Patientin oder Patient, soll auf 40 Prozent abgesenkt werden. Hinzukommt, dass in Zukunft zwei komplexe und komplizierte Abrechnungsmodalitäten bestehen: DRG und Vorhaltepauschalen.
Ein wesentlicher Grund für die finanzielle Krise der Krankenhäuser ist. dass die Länder ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachkommen. Dass die Finanzierung der Investitionen nun über den Transformationsfonds erfolgen soll, der zur Hälfte von der GKV finanziert werden soll, ist aus Sicht des BvDU abzulehnen. Hochproblematisch ist aus Sicht des Berufsverbands auch, dass die Ärzteschaft nicht beteiligt ist bei einem geplanten Susschuss, der als zusätzliches Beschlussgremium zur Erarbeitung von Empfehlungen zur Festlegung von Qualitätskriterien für die Leistungsgruppen per Rechtsverordnung gebildet wird. Keine Vertreter der Selbstverwaltung sollten dort vertreten sein – ein absolutes No-Go aus Sicht des Berufsverbands.
Evaluation statt Auswirkungsanalyse
Aus Länder-Sicht ist damit nicht nur die Ausgestaltung der geplanten neuen Vergütungssystematik unklar, sondern auch deren Auswirkungen. Die vom Bund versprochene „valide, aussagekräftige und wissenschaftlich fundierte Auswirkungsanalyse und Folgenabschätzung“ taucht auch im
aktualisierten Entwurf mit keinem Wort auf.
Vorgesehen ist stattdessen immer noch eine Evaluation des KHVVG. Dazu sollen der GKV-Spitzenverband (GKV-SV), der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) dem BMG und den für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden zum 31. Dezember 2028, zum 31. Dezember 2033 sowie zum 31. Dezember 2038 jeweils einen gemeinsamen Bericht vorlegen – und zwar über folgende Punkte: die Auswirkungen der Festlegung der Leistungsgruppen, die Erfüllung der Qualitätskriterien durch den Medizinischen Dienst (MD) sowie die Auswirkungen des KHVVG auf die Versorgungssituation der Patient:innen, die Personalstrukturen in den Krankenhäusern, die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser und die Ausgaben der Krankenkassen sowie auf weitere Versorgungsbereiche wie etwa jenen der medizinischen Rehabilitation.
Neben der Forderung nach einer echten Auswirkungsanalyse und für die Länder funktionierende Ausnahmefälle gehören zu den wichtigsten geeinten Forderungen der Länder eine schnelle Vorlage der aus dem Gesetzentwurf ausgelagerten Rechtsverordnungen. Zwar erklärte Lauterbach nach der letzten Bund-Länder-Runde, sich vorstellen zu können, die Rechtsverordnungen „etwas vorzuziehen“. Im Kabinettsentwurf heißt es nun: „Die Rechtsverordnung ist erstmals bis zum 31. März 2025 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2027 zu erlassen.“ Den Ländern geht es aber nicht nur um die Fristen,
sondern um die Befürchtung, nicht ausreichend bei der Ausarbeitung der Leistungsgruppen eingebunden zu werden.
Geplant ist, dass der KHVVG-Entwurf noch vor der Sommerpause in die erste Bundestagslesung geht.
Exkurs: Krankenhausstrukturreform – im Zentrum aller Reformvorhaben der Bundesregierung
Grundsätzlich begrüßt der BvDU die überfällige Krankenhausstrukturreform.
Für die Reform soll ab 2025 ein Transformationsfonds über zehn Jahre aufgebaut werden, mit einem Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro, je zur Hälfte finanziert von Bund und Ländern. So sollen langfristig Geld eingespart oder zumindest die Kosten im Gesundheitswesen gedämpft werden. Der Bund will seinen Anteil von 25 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) speisen. Das wären pro Jahr 2,5 Milliarden Euro an Transformationskosten für die Versicherten. Die Bundesländer übernehmen 2,5 Milliarden Euro pro Jahr.
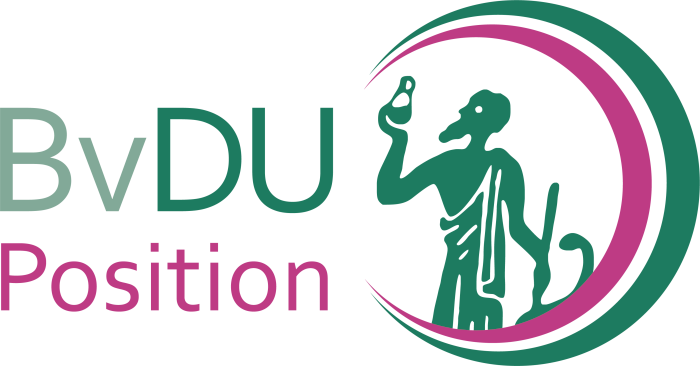
50 Prozent des Transformationsfonds würden zu Lasten der Krankenkassen und Versicherten gehen
Der Berufsverband stellt klar, dass mit der angedachten Lösung 50 % des Transformationsfonds zu Lasten der Krankenkassen und damit der gesetzlich Versicherten gehen würden. Der GKV-Spitzenverband hat bereits ein Rechtsgutachten beauftragt, das besagt, dass die geplante Finanzierung des Transformationsfonds durch die GKV ein klarer Rechtsbruch wäre. Hinzu kommt, dass private Krankenversicherungen (PKV) nicht davon betroffen wären und somit dies somit eine Ungleichbehandlung der gesetzlich und privat Versicherten zur Folge hätte.
Quellen: Tagesspiegel Background. Ärzte Zeitung, Ärztenachrichtendienst (änd), Deutschlandfunk

